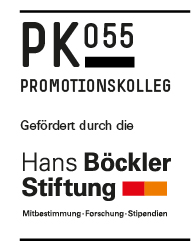Forschungsprogramm

Alternde Gesellschaften sind Gesellschaften, die sich ständig neu erfinden müssen – dies gilt sowohl auf der politischen wie auf der sozialen Ebene, also im Hinblick auf Institutionen und soziale Beziehungen, als auch im Alltag eines/r jeden. Alt sein heute ist nicht gleich alt sein morgen. Wenn Gesellschaften altern, betrifft dies keineswegs nur die „Alten“ bzw. den zunehmenden Anteil älterer und hochaltriger Menschen an der Bevölkerung, sondern alle, auch Kinder und Jugendliche und Menschen im mittleren Lebensalter, es betrifft Individuen und Familien sowie das gesamte Gesundheits- und Sozialsystem, Rentensysteme und das Zusammenleben und –arbeiten. Wir werden „weniger, älter, bunter“ – dies ist ein weltweiter „Megatrend“, der für alle mit grundlegenden sozialen Veränderungen einhergeht und vielfältige Herausforderungen mit sich bringt. All dies ist insbesondere in Zeiten multipler Krisen (Pandemie, Kriege, Klima) mit tiefgreifenden sozialen und ökonomischen Folgen von fundamentaler Bedeutung für die Sicherung von Teilhabe, guten Lebens- und Arbeitsbedingungen und gesellschaftlicher Solidarität.
Im Kolleg werden die neuen Herausforderungen, die der demografische Wandel in Zeiten multipler Krisen (Pandemie, Kriege, Klima) für Individuen, Familien und Gesellschaften mit sich bringt, erforscht und gefragt: Wie lässt sich selbstbestimmtes Altern für alle in zentralen Lebensbereichen und über den gesamten Lebenslauf ermöglichen? Wie lässt sich generationengerechte soziale Teilhabe in alternden Gesellschaften gestalten? Aus multi-methodischer und inter-disziplinärer Mehrebenen-Perspektive sind die zwölf Promotionen in acht eng miteinander verzahnten Themenfeldern angesiedelt. Wir skizzieren im Folgenden mögliche Forschungsfragen.
I. Erwerbsarbeit und soziale Sicherung (Brandt, Howaldt, Motakef)
Wie sollten teilhabesichernde Rentensysteme in alternden Gesellschaften beschaffen sein? Welche Gestaltungsbedarfe für Erwerbsarbeit bestehen, wenn altersbezogene Bedürfnisse der Beschäftigten ernstgenommen werden?
II. Organisation und soziale Innovation (Howaldt, Wilkesmann)
Welche sozial-innovativen organisationalen Ansätze und Lösungsansätze liegen vor, um Teilhabe in Organisationen zu sichern? Welche Rolle spielen dabei digitale Technologien?
III. Lebensbegleitendes Lernen (Reichert, Wilkesmann)
Wie kann lebensbegleitendes Lernen organisiert werden, dass bestimmte Personengruppen nicht systematisch benachteiligt werden? Wie lässt sich Wissenstransfer in Betrieben sichern?
IV. Familie und Vereinbarkeit (Brandt, Motakef, Reichert)
Wie verändern sich angesichts des demografischen Wandels die Lebenslagen und Teilhabemöglichkeiten sorgender Angehöriger? Welche Rolle spielen dabei die (veränderten) rechtlichen, sozialpolitischen und betrieblichen Rahmenbedingungen für Familien? Was sind Folgen für Geschlechterungleichheiten?
V. Gesundheit, Pflege und soziale Unterstützung (Brandt, Reichert)
Wie Pflege im Sinne guten und selbstbestimmten, gesunden Alterns für Pflegende und Gepflegte gelingen? Wie können Pflegebedingungen verbessert werden? Welche Rolle spielen Arbeitsmigration, soziale Netzwerke, regionale Angebote, technologische Entwicklungen oder pandemische Krisen?
VI. Wohnen und Quartiersentwicklung (Burzan, Brandt, Frank, Poferl)
Welche Wohnkonzepte werden notwendig, die sich nicht mehr an der bürgerlichen Kleinfamilie orientieren? Wie kann Wohnungspolitik generationengerecht gestaltet werden? Wie kann das Problem von Einsamkeit nicht nur, aber insbesondere im höheren Alter bearbeitet werden?
VII. Soziale Rechte und Gerechtigkeit (Brandt, Motakef, Poferl)
Wie entwickelt sich Generationengerechtigkeit im Hinblick auf Mitbestimmung und Teilhabe in Krisenzeiten? Inwiefern macht es einen Unterschied, ob es dabei z.B. um soziale Sicherung oder den Klimaschutz geht?
VIII. Ungleichheit und Lebenslagen (Brandt, Burzan, Frank, Motakef)
Wie entwickeln sich (ungleiche) Teilhabechancen über den Lebenslauf und den Familienzyklus? Welche Interventionsmöglichkeiten lassen sich identifizieren? Welche Bedeutung haben Lebensstile bei der Reproduktion von Ungleichheiten, was verändert sich über die Zeit? Altern „queere“ Menschen anders und falls ja, was bedeutet dies für die Lebenslaufforschung?
Im Promotionskolleg sollen nicht nur eklatante Forschungslücken gefüllt, sondern auch Gestaltungsbedarfe eruiert und Maßnahmen zur Sicherung von Teilhabe in alternden Gesellschaften beteiligungsorientiert (weiter-)entwickelt werden. Auf Multiperspektivität ausgerichtet, kommen elaborierte und innovative quantitative, qualitative, kombinierte sowie transformative Methoden zum Einsatz. Durch ein breites Maßnahmen-Set werden die regionale, nationale und internationale Sichtbarkeit der Forschungsergebnisse, der nachhaltige Transfer und die Vernetzung der Stipendiat*innen unter Einbezug von „stakeholdern“ aus Politik und Wirtschaft systematisch gefördert.