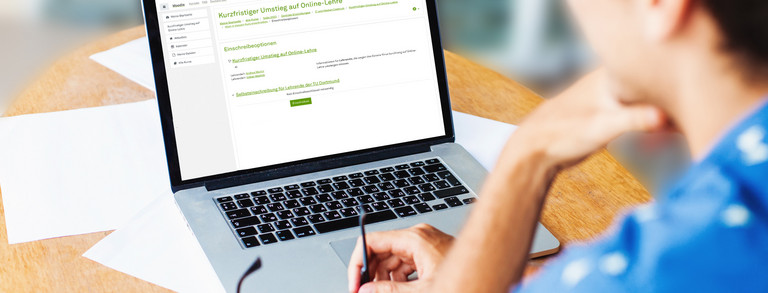Was ist los mit den neuen Vätern?
- News
- Fakultät

Der Wille ist da, das Leben ist schwach: Der Soziologe Michael Meuser erklärt, warum es gerade im bürgerlichen Milieu zu wenig Gleichheit unter Vätern und Müttern gibt.
Geht es nach Vaterbuch-Neuerscheinungen, wird man das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts im Rückblick womöglich als die Dekade der Entdeckung des "neuen Vaters" bezeichnen. Der "neue Vater" steht morgens nicht nur auf Spielplätzen, mittags in der Küche, nachts am Wickeltisch – er schreibt auch gerne Bücher darüber. Wie kommt es dann aber, dass nach wie vor Mütter den größeren Teil der Sorgearbeit in den Familien leisten? Und hat das Homeschooling der Kinder die Gleichberechtigung in Familien, wie befürchtet, zurückgeworfen? Wir haben den Soziologen Michael Meuser gefragt, der den Eltern- und Familiendiskurs seit Jahrzehnten verfolgt.
ZEIT ONLINE: Herr Meuser, vor einem Jahr gab es die Befürchtung, die Corona-Pandemie könne zu einer Retraditionalisierung im Bereich der Familien führen. Mütter, erzwungen durch Homeschooling und Homeoffice, seien danach noch mehr als ohnehin für die Kinderbetreuung zuständig. Ist es so gekommen?
Michael Meuser: Es gibt mittlerweile mehrere empirische Studien dazu, inwiefern sich die Arbeitsverteilung zwischen Müttern und Vätern unter Corona-Bedingungen verändert hat. Man kann ihnen nicht entnehmen, dass sich die Aufgabenverteilung insgesamt stärker traditionalisiert. Aber die Befunde sind uneinheitlich.
ZEIT ONLINE: Das heißt?
Meuser: Das heißt, wir sehen verschiedene Entwicklungen, die zeitgleich ablaufen. Es gibt zu etwa gleichen Teilen eine Entwicklung hin zu mehr partnerschaftlicher Arbeitsteilung in den einen Familien. Und eine Entwicklung hin zu einer ungleicheren Aufteilung in anderen Familien. Ein Befund, den man verallgemeinern kann, ist, dass sowohl Väter als auch Mütter in der Pandemie mehr Zeit für Kinderbetreuung aufgewendet haben als vorher. In einer von Allensbach durchgeführten Studie zeigt sich, dass die Aufgabenteilung im Verhältnis insgesamt eher unverändert geblieben ist. Das betrifft die Mehrzahl der Familien.
ZEIT ONLINE: In einem Viertel der Familien, in denen sich die Eltern vor der Krise die Betreuung gleichmäßig aufgeteilt hatten, leistete die Mutter während der Pandemie mehr als der Vater. In zehn Prozent der Familien war es der Vater. Das ergab eine Befragung im Auftrag der Böckler-Stiftung. Zumindest in dieser Untergruppe könnte man eine Retraditionalisierung sehen.
Meuser: Ja, aber gesamtgesellschaftlich gesehen weist die Studienlage weder in Richtung einer stärkeren Traditionalisierung, noch sehen wir eine wesentliche Trendumkehr.
ZEIT ONLINE: Wie fügt sich das ein in die Dynamik der vergangenen Jahre?
Meuser: Nun, das sind generelle Tendenzen, die es unabhängig von Corona gibt: Zum einen ist die Beteiligung der Väter größer geworden, und das geht weiter. Zum anderen besteht trotz der drei oder vier Jahrzehnte währenden Gleichheitsdebatte immer noch eine Kluft zwischen den formulierten Ansprüchen und der alltäglichen Praxis in den Familien.
ZEIT ONLINE: Wie drückt sich die Kluft in Zahlen aus?
Meuser: In 28 Prozent der Paarfamilien mit Kindern unter 18 Jahren ist der Vater immer noch Alleinverdienender. Nur in zwölf Prozent der Familien arbeiten beide Eltern Vollzeit. Am stärksten verbreitet mit 44 Prozent ist eine Vollzeiterwerbstätigkeit des Vaters und eine Teilzeiterwerbstätigkeit der Mutter. Das traditionelle Modell des Alleinernährers ist also nicht mehr die vorherrschende Lebensrealität, es spielt aber immer noch eine Rolle. Momentan haben wir ein modifiziertes Ernährermodell: Der Vater trägt hauptsächlich zum Erwerbseinkommen bei, die Mutter auch, aber nicht im gleichen Maß wie der Vater. Die Betreuung der Kinder obliegt damit nach wie vor mehr den Müttern. Die Männer sind aber nicht mehr die "abwesenden Väter", wie es früher einmal als Formel hieß.
"Die Familie kann zu einem Ort von Geschlechterkonflikten werden"
ZEIT ONLINE: Kann man die Entwicklungen bestimmten gesellschaftlichen Milieus zuordnen?
Meuser: In einem bürgerlichen, vor allem auch akademisch gebildeten Milieu gibt es einen starken Diskurs, der ausgerichtet ist auf partnerschaftliche Verteilung der Aufgaben. Dieser Diskurs korrespondiert aber nicht mit einer entsprechenden Praxis. Das klafft gerade in diesem Milieu stark auseinander.
ZEIT ONLINE: Der Soziologe Ulrich Beck hat das Phänomen schon vor Jahrzehnten als "verbale Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre" beschrieben.
Meuser: Auf der anderen Seite konnten wir in eigenen Studien feststellen, dass es in einem Milieu von Arbeitern und einfachen Angestellten gar nicht so sehr diesen Geschlechtergleichheitsdiskurs gibt.
ZEIT ONLINE: Jetzt sagen Sie aber nicht, da wird, statt zu reden, einfach gemacht.
Meuser: Nun, man kann sehen, dass sich in diesen Milieus im Alltag auf einer pragmatischen Ebene oft mehr Tendenzen zu partnerschaftlicher Arbeitsteilung einstellen. Familien, in denen Schichtarbeit geleistet wird, wären ein Beispiel dafür.
ZEIT ONLINE: Wie erklärt sich das?
Meuser: Weil die Schichten von Vater und Mutter zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, ist es organisatorisch schlichtweg notwendig, dass die Kinderbetreuung auch durch den Vater geleistet wird. Wir sehen hier im Grunde etwas, was wir auch international in Studien zur Elternzeitverteilung sehen.
ZEIT ONLINE: Zur Frage, wie sich Mütter und Väter die Elternmonate aufteilen?
Meuser: Genau. Wenn Väter sich daran beteiligen, hat es vor allem dann eine nachhaltige Wirkung, wenn sie ihre Elternmonate unabhängig von der Elternzeit der Mutter nehmen. Also nicht zeitgleich. Dadurch dass der Vater dann einige Monate lang für die Kinderbetreuung hauptverantwortlich ist, entwickeln sich neue Alltagsroutinen. In ähnlicher Weise kann man die Studien zu den Schichtarbeiterfamilien verstehen. Allein die Tatsache, dass man regelmäßig als Vater alleinverantwortlich für die Kinderbetreuung ist, führt dazu, dass neue Routinen ausgebildet werden.
ZEIT ONLINE: Das heißt, wenn wir über "neue Väter" sprechen, müssen wir auch über die Vater-Mutter-Beziehung sprechen?
Meuser: Was man auf jeden Fall sagen kann: Die Erfahrung von Eigenverantwortlichkeit in der Kinderbetreuung ist ein entscheidender Faktor dafür, dass sich eine sorgeorientierte Vaterschaft nachhaltig ausbildet.
ZEIT ONLINE: Müssten sich Mütter also stärker aus der Betreuung raushalten?
Meuser: Nein, raushalten nicht, das ist nicht gemeint. Aber natürlich spielt die Mutter eine Rolle. In unserer kulturellen Tradition ist die Kinderbetreuung deutlich als ein Terrain der Mutter etabliert. Sowohl bei der Mehrzahl der Väter als auch bei der Mehrzahl der Mütter besteht klar die Vorstellung, dass die Mutter sorgekompetenter ist als der Vater. Das zeigt sich etwa in einer Studie des Deutschen Jugendinstituts auf Grundlage einer Befragung. Wenn Väter sich nun verstärkt selber engagieren – und das auf Dauer –, muss neu verhandelt werden, wer die Entscheidungskompetenz hat, wie gute Betreuung aussieht. Das läuft innerhalb der Partnerschaft nicht immer konfliktfrei ab.
ZEIT ONLINE: Was sind denn häufige Konflikte diesbezüglich?
Meuser: Wenn Väter eine solche Entscheidungskompetenz auch für sich beanspruchen, kann die Familie zu einem Ort von Geschlechterkonflikten werden, die es in dieser Form im Rahmen der traditionellen geschlechtlichen Arbeitsteilung nicht gegeben hat. Die Art, wie die Kinderbetreuung praktiziert wird, wird zu einem Gegenstand andauernder Diskussionen und Verhandlungen zwischen den Partnern. Die Familie wird zu einer "Verhandlungsfamilie" – nicht nur im Sinne einer Aushandlung darüber, wer in welchem Maße welche Arbeit macht, sondern auch über die Festlegung der Standards von Kinderbetreuung und sonstiger Familienarbeit.
"Prominente Beispiele können starke symbolische Wirkung entfalten"
ZEIT ONLINE: Eine Familie, die kein traditionelles Mutter-Vater-Rollenverhältnis pflegt, ist die von Annalena Baerbock, die als erste Mutter mit kleinen Kindern ins Kanzleramt will. Sie sagt, ihr Mann sei für Haushalt und Kinderbetreuung zuständig. Kann solch ein Beispiel etwas aufbrechen, oder ist das nur ein Einzelfall, der gesellschaftlich nicht relevant ist?
Meuser: Beispiele von prominenten Menschen können eine starke symbolische Wirkung entfalten. Sie zeigen zumindest, dass Familie auch anders lebbar ist als nach einem traditionellen Muster. Bedeutsam sind aber vor allem Rollenvorbilder in alltäglichen Lebenszusammenhängen. Ob ein vorgesetzter Mann im Betrieb Elternzeit nimmt, kann einen starken Effekt darauf haben, ob sich auch andere Väter im Betrieb trauen, mehr als zwei Monate Elternzeit zu nehmen.
ZEIT ONLINE: An den eigenen Vater kann man sich in der Regel leider nicht wenden, wenn man Rat sucht, oder?
Meuser: Das Vorbild des eigenen Vaters ist schon wichtig für das Verständnis von Vaterschaft. Aber vor drei, vier Jahrzehnten war der Mann als Alleinernährer der Familie eben noch deutlich stärker verbreitet, als das gegenwärtig der Fall ist.
ZEIT ONLINE: Der dänische Familientherapeut Jesper Juul schrieb in seinem Buch Mann & Vater sein andererseits, er habe sich in den Sechzigerjahren auch schon als "neuer Vater" bezeichnet.
Meuser: Das mag sein, aber in Deutschland war in den Sechzigerjahren die Beteiligung der Väter an der Kinderbetreuung deutlich geringer als heute. Wenn sie sich heute vermehrt im Alltag zu Hause engagieren, erleben die Kinder das natürlich als etwas Normales. Das ist gewiss von Bedeutung für die Frage, ob sich ein verändertes Verständnis von Vaterschaft mittel- oder langfristig etablieren und durchsetzen kann.
ZEIT ONLINE: Das heißt, wir reden über einen Generationenprozess?
Meuser: Aus soziologischer Perspektive ist nicht zu erwarten, dass sich ein neues Modell von Vaterschaft, das es auf der Ebene der gesellschaftlichen Diskurse seit Jahrzehnten gibt, im Zeitraum eines Jahrzehnts allgemein durchsetzen wird. Das sind lange Prozesse. Das kann man sich auch verdeutlichen, wenn man in die skandinavischen Länder schaut, etwa nach Schweden, wo es schon Mitte der Siebzigerjahre, also vor fast 50 Jahren, eine Familienpolitik gab, die ganz gezielt an Väter gerichtet war und diese einbezieht. Dort gehen heute zirka 80 Prozent der Väter in Elternzeit.
ZEIT ONLINE: In Deutschland sind es nur etwa 40 Prozent. Was für ein Vater ist das in Schweden? Eine Art zweite Mutter?
Meuser: Nein (lacht), von einer zweiten Mutter kann man nicht sprechen. Es gibt ganz unterschiedliche Weisen, wie väterliches Engagement praktiziert wird. Es gibt eine Form von Väterlichkeit, die an der Vorstellung von Mütterlichkeit orientiert ist. Und es gibt Väterlichkeit, die versucht, in der Sorge um die Kinder einen spezifisch männlichen Akzent zu setzen, indem der Vater sich weniger an den alltäglichen Aufgaben der Pflege und der im Zuge der Kinderbetreuung anfallenden Hausarbeiten beteiligt, sondern zum Beispiel mit den Kindern etwas unternimmt.
ZEIT ONLINE: Was verbindet dann eigentlich die "neuen Väter", wenn es so viele unterschiedliche Vorstellungen davon gibt?
Meuser: Der neue Vater ist einer, der nicht mehr nur das Engagement für die Familie in den Vordergrund stellt, was die traditionelle Rolle des Ernährers impliziert, sondern er ist eine Figur, die in der Familie engagiert ist. Er akzentuiert das fürsorgliche Engagement stärker, ohne die Ernährerfunktion völlig auszusetzen. Ein Vaterschaftsverständnis, das nur auf die Funktion des Ernährers begrenzt ist, ist zunehmend gesellschaftlich entwertet.
ZEIT ONLINE: Aber Ernährer muss er schon noch sein?
Meuser: Das heutige Idealbild ist das eines Vaters, der in der Familie emotional engagiert und in der Betreuung präsent ist, gleichwohl aber auch noch seine Ernährerfunktion erfüllt. Das wird auch von einer Mehrzahl der Mütter immer noch erwartet. Insofern ist ein Spagat erforderlich. Studien, in denen es um die Arbeitszeitwünsche von Vätern geht, zeigen, dass sie weniger arbeiten wollen als bisher, sie wollen in der Betreuung präsent sein. Aber es gibt immer noch eine Diskrepanz. Am Wochenende gibt es kaum noch Unterschiede in der aufgewendeten Zeit mit den Kindern. Unter der Woche tun die Mütter aber deutlich mehr.
ZEIT ONLINE: Wie kommen wir vom Reden zur Umsetzung?
Meuser: Tatsächlich gehört ein Vater, der weniger als 25 Stunden pro Woche arbeitet, mit größerer Wahrscheinlichkeit zu den neuen, in der Familie aktiven Vätern. Man könnte Anreize schaffen, etwa durch Arbeitszeitmodelle, sodass es attraktiv ist für Eltern, wenn beide nicht Vollzeit erwerbstätig arbeiten. Aber die Politik kann nur für die Rahmenbedingungen sorgen. Ihre Möglichkeiten, Einstellungen direkt zu verändern, sind gering. Den ernährenden und den fürsorgenden Vater in Übereinstimmung zu bringen, stellt die zentrale Herausforderung dar für eine neue Praxis von Vaterschaft.
Den Originalartikel lesen Sie auf zeit.de, der wir herzlich für die Erlaubnis der Veröffentlichung des Interviews auf dieser Seite danken möchten.